Izzy Kramer
Nephilim
Nephilim
NOMINIERT FÜR DEN SERAPH 2023 - BESTES DEBÜT
Kaum mehr als zehn Meter entfernt tanzt eine junge Frau im milchigen Schein einer Straßenlaterne. Ihr weißblondes Haar funkelt im Licht. Sein überraschter Blick gleitet über ihr Gesicht, ihren schmalen Leib; und ihre Stimme, die eine sanfte Melodie in einer fremden Sprache singt, fesselt seine Sinne.
Etwas so Schönes hat er noch nie gesehen.
Sie nennen ihn »Goliath« und »Leviathan«, doch eigentlich hat er keinen Namen. Übergroß, mit weißen Augen und ebenso weißen Haaren, ist er stets ein Außenseiter, der sich mit zwielichtigen Jobs über Wasser hält. An die ständige Einsamkeit ist er seit dem Tod seiner Ziehmutter Sophia längst gewöhnt. Auf der Jagd nach ihrem Mörder durchkämmt er Londons Straßen, nur begleitet von dem letzten Geschenk, das er von ihr erhalten hat.
Längst ist er überzeugt, versagt zu haben und sie niemals rächen zu können, bis er eines Nachts eine geheimnisvolle junge Frau trifft, die Sophia verblüffend ähnelt …
Seiten: 278
Izzy Kramer
ISBN:978-3-96964-024-1
Seiten: 278
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
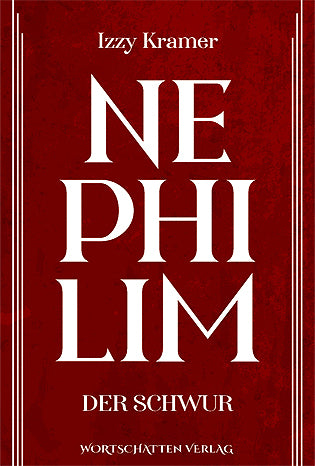

Izzy Kramer
Leseprobe
 NEWSLETTER
NEWSLETTER
 KONTAKT
KONTAKT


